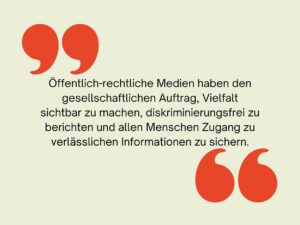Die Situation für Medienschaffende in Mexiko ist lebensbedrohlich, vor allem für Frauen. ANNA IDA FIERZ über das Leben für den Journalismus und den Umgang mit einer schier unerträglichen Situation.
„Kill the messenger“ ist in Mexiko keine Metapher. María del Refugio Martínez Guardado sitzt in einer Wohnung in einer mexikanischen Stadt. Dunkle Haare, Lippenstift, müde. Sie kommt gerade von einem Interview. Mit dabei: Personenschutz. Es ist fünf Jahre her, seit sie das letzte Mal alleine bei der Arbeit war, einkaufen oder um den Block spazieren. Die 57jährige ist im Schutzprogramm für Menschenrechtsverteidiger_innen und Journalist_innen (Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas).
Das Richtige tun
Maria ist Investigativjournalistin. Sie recherchiert zu organisierter Kriminalität, berichtet von Politik, Korruption und Drogenhandel in Aguascalientes. Seine geographische Lage macht den Bundesstaat zu einem wichtigen Zentrum für das organisierte Verbrechen und zu einem Knotenpunkt für das Cártel de Jalisco Nueva Generación.
2022 veröffentlicht Maria einen Artikel über die Zusammenhänge zwischen dem Drogenhandel und der Lokalpolitik in der mittelgroßen Stadt Rincón de Romo. Noch am selben Tag erreicht Maria die Drohung „Wie viel haben sie dir bezahlt, Hurentochter?“, zusammen mit einem Foto der Journalistin, das sich langsam auflöst. „Natürlich hatte ich Angst.“ Maria soll den Artikel löschen und das Thema begraben.
Doch Maria lässt den Artikel online, sieht die Drohung als Angriff auf ihre Meinungsfreiheit. „Als Journalistin ist es meine Pflicht, zu recherchieren und den Leser_innen die Informationen zu liefern, die sie brauchen, um sich eine eigene Meinung zu bilden.“ Zu dieser Zeit schreibt Maria an einem Buch über den Drogenboss Rafael Caro Quintero. Dieser meldet sich direkt bei ihr: „Ich habe vier bewaffnete Männer hier auf meiner Ranch, die verlangen, dass ich dich anrufe, damit du herkommst, weil sie dich töten wollen.“
Ein realer Krimi
Nach unzähligen Anrufen, Drohungen, Belästigungen reicht Maria Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft Mexikos ein. Sie ahnt nicht, welche Konsequenzen das mit sich bringen würde. „Ich hatte die Ernsthaftigkeit der Drohungen noch nicht verstanden. Nicht nur kriminelle Gruppen, auch die Staatsanwaltschaft von Aguascalientes selbst hat eine regelrechte Jagd auf mich eröffnet. Man hat ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet, als wäre ich die Kriminelle.“ Die Anzeige beschreibt Maria als retraumatisierend.
Ihr wird klar, dass die Behörden in Aguascalientes die kriminellen Gruppen schützen. Ihre Dokumentation der Korruptionsfälle führt dazu, dass sie direkt von der Policía Ministerial bedroht wird. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch ein Richter legen ihr nahe, Veröffentlichungen zu diesen Themen zu unterlassen. Aber Maria schreibt weiter.
Was danach kommt, gleicht einem brutalen Krimi, der nicht enden will. Zwei ihrer Informantinnen werden entführt, eine wird freigelassen, die andere ermordet. Zu Maria dringt die Botschaft durch, alles sei Schuld der „Hurenjournalistin“. Maria, sie hat einen Sohn und drei Enkelkinder, verlässt Aguascalientes. Sie wird nun 24/7 begleitet, ihr Aufenthaltsort geheimgehalten, selbst vor ihrer Familie.
Doch aufgehört, hat sie nicht: „Ich schreibe jeden Tag Geschichten.“ Auf ihrem Portal Péndulo Informativo veröffentlicht Maria ihre Texte. Sie sieht in ihrer Arbeit eine soziale Verantwortung. Viele haben ihr gesagt, keine Geschichte ist mehr wert als dein Leben, aber Maria ist überzeugt, wenn sie jetzt aufhört, macht sie sich zur Komplizin. Maria weint: „Das hier kostet mich das Leben, weißt du.“
Für die Meinungsfreiheit
Um weiterhin im Schutzprogramm für Journalist_innen zu bleiben, muss sich Maria erneut einer Evaluation aussetzen. „Du sitzt stundenlang vor einem Gutachter und erzählst, was du erlebt hast. Sie verlangen Details über Details, Dinge, die du am liebsten vergessen würdest. Du gibst dein ganzes Leben preis.“ Die Informationen aus diesen Gutachten fließen direkt in die Ermittlungsakten. Und diese Akten werden an die Täter weitergegeben, weil es ihr verfassungsmäßiges Recht ist, über die Ermittlungen informiert zu werden.
„Es gibt keinen Schutz für dich als Opfer“, sagt Maria. Auch eine geschlechtersensible Perspektive bei den Ermittlungen gebe es nicht: „Ich weiß, dass ich gegen ein Monster mit tausend Köpfen kämpfe, aber ich kämpfe nicht um des Kämpfens willen. Ich kämpfe, um zu informieren.“
Maria lebt vom Journalismus, liebt ihre Arbeit und kann sich trotz der unerträglichen Situation nichts anderes vorstellen. „Ich möchte bis zu meinem letzten Atemzug für das kämpfen, woran ich glaube: Journalismus, Gerechtigkeit und Freiheit.“
Ein Wunder
In ihrem klitzekleinen Innenhof in einer Stadt in Mexiko wächst Chile, das Kraut Pápaloquelite, Jitomates Criollos und so einiges mehr. Marcela de Jesús Natalia macht das Beste aus einer schier hoffnungslosen Situation. „Man hat mich aus dem Dorf weggebracht, aber das Dorf ist mit mir gekommen.“ Doch in der traditionellen Kleidung, dem farbigen Huipil, kann sie nicht vor die Tür gehen. Und zu ihrer Gemeinschaft in Guerrero kann sie auch nicht zurück.
Dort, in ihrem Dorf, es war ihr Geburtstag, der 3. Juni 2017, hat sie einen Mordanschlag überlebt. Es kann nichts anderes sein als ein Wunder, sagen alle, die die Geschichte kennen. Drei Kugeln aus nächster Nähe. Warum? Weil Marcela es sich als Radiojournalistin und Aktivistin zur Aufgabe gemacht hat, ihre indigene Gemeinschaft auf Ñomndaa zu informieren.
Ihre journalistische Laufbahn startet Marcela 1994 beim indigenen Community Radio XEJAM-AM (La Voz de la Costa Chica) in Santiago Jamiltepec im Bundesstaat Oaxaca. Auf die Frage des Chefs, warum sie Radiomoderatorin werden wolle, antwortete sie: „Weil ich die Stimme meiner Gemeinschaft sein will. Ich will meinem Volk sagen, dass wir Rechte haben, dass wir gleich sind – bei Bildung, Landrechten und in Bezug auf unsere natürlichen Ressourcen.“ Zum ersten Mal war eine indigene Frau in einem Massenmedium zu hören. „Ich fühlte mich wie ein Hollywoodstar! Meine Mitbürger_innen kletterten sogar auf Bäume und spannten einen Draht als Antenne, um mich über ihr Radio hören zu können.“
Dieses Glück hielt nicht lange. Vier Jahre später, am 8. März 1998, wird Marcela willkürlich und zusammen mit ihrem minderjährigen Sohn festgenommen. Ihr wird Anstiftung zu einem bewaffneten Überfall vorgeworfen. Die Behörden behaupteten, sie hätte alles geplant. „Dabei war ich an dem Tag, an dem ich angeblich das Verbrechen geplant haben soll, von fünf Uhr morgens bis acht Uhr abends für einen Auftrag in Guerrero – nicht in Oaxaca.“ Es wird zwei Mal die Höchststrafe von 40 Jahren gefordert. Schließlich verbringt Marcela drei Jahre und fünf Tage unschuldig im Gefängnis.
Weiterhin Widerstand
Dann kommt der Moment vor acht Jahren. Marcela zeigt die Stellen in ihrem Gesicht: „Die Kugel, die hier eindrang, zertrümmerte meinen Schädel, durchquerte ihn, streifte die Wirbelsäule und wanderte durch meinen Körper.“ Drei Kugeln insgesamt. „Ich habe gekämpft, um zu überleben – körperlich und seelisch.“ Beides war unglaublich schmerzhaft, aber Marcela ist noch immer hier. „Ich schreie es in die Welt hinaus: Das Ñomndaa-Volk existiert – und wir leisten weiterhin Widerstand. Keine Gefängniszelle, keine drei Kugeln haben jemals geändert, was ich schon als Kind in mir trug: Aktivistin und Menschenrechtsverteidigerin zu sein – und Journalistin.“
Aktuell kämpft auch Marcela dafür, dass ihr Schutzstatus verlängert wird. Er soll ihr entzogen werden. „Wie kann ich denn nicht gefährdet sein, wenn nicht einmal gegen die mutmaßliche Auftraggeberin der Tat ermittelt wurde?“ Marcelas Fall hat jedoch medial große Beachtung gefunden. Ihre Vorträge über ihre Erfahrungen werden bei indigenen Radiosendern veröffentlicht. „Diese Sichtbarkeit hat mein Leben gerettet“, ruft Marcela. Ihr größter Wunsch sei es, dass die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit macht. „Ich habe das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Ich habe das Recht auf umfassende Wiedergutmachung.“
Keine Einzelfälle
Maria und Marcela sind keine Einzelfälle. In Mexiko Journalist_ in oder Medienschaffende zu sein ist lebensbedrohlich. Laut Reporter ohne Grenzen ist es für Medienschaffende, nebst Kriegsgebieten, eines der gefährlichsten und tödlichsten Länder der Welt. Das liegt auch an der hohen Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalist_innen. Mexiko belegt 2025 auf dem jährlichen Pressefreiheitsindex Platz 124 von 180. Bereits sieben Journalist_innen wurden dieses Jahr umgebracht. Viele sind verschwunden. Oder verstummt. Unzählige haben ihren Beruf aufgegeben.
„Wir erleben eine schwere Menschenrechtsverletzung“, sagt die Journalistin Lucía Lagunes Huerta, die seit 20 Jahren die Organisation CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C) leitet. Diese begleitet und betreut Journalistinnen und publiziert mit der eigenen Nachrichtenagentur journalistische Inhalte mit Fokus auf Menschenrechte und Geschlechterperspektiven.
„Für uns Journalist_innen wird es immer schwieriger, kritische Perspektiven zu veröffentlichen – also genau das, wofür wir da sind.“ Noch nie zuvor wurden so viele Journalist_ innen ermordet, obwohl sie unter dem staatlichen Schutzmechanismus standen.
CIMAC führte eine Umfrage zum Einfluss von Gewalt auf Journalist_innen durch. Dabei wurde klar: Frauen überlegen deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen, den Beruf aufzugeben. „80 % der befragten Kolleginnen haben schon darüber nachgedacht, den Journalismus wegen der Gewalt, die sie erleben, zu verlassen.“ Die ständige Gewalt hinterlässt Spuren: Frauen erleiden Lähmungen im Gesicht oder am ganzen Körper, sie entwickeln chronische Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck. Lucía ruft: „Wie soll unter solchen Bedingungen guter Journalismus möglich sein?“
Für CIMAC ist der gesetzliche Auftrag klar: Es muss alles getan werden, um das Leben, die Sicherheit und die journalistische Arbeit der betroffenen Frauen zu gewährleisten. Gleichzeitig liegt der Fokus auf Acompañamiento, der Begleitung der Journalistinnen, von Frauen wie Maria und Marcela. Denn Schutz wird oft nur physisch gedacht: in Form von Schutzwesten, gepanzerten Fahrzeugen. „Aber für uns ist Schutz etwas Ganzheitliches.“ Um dem Mut dieser Frauen gerecht zu werden.
***
Anna Ida Fierz ist Sozialanthropologin und freie Journalistin. Sie beschäftigt sich mit feministischer Medienarbeit und setzt Audioprojekte im interkulturellen Bereich um. Am allerliebsten schreibt sie Musikrezensionen für die frauen*solidarität.