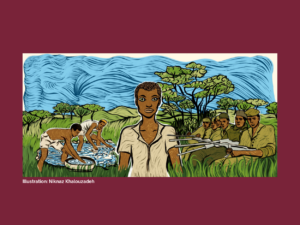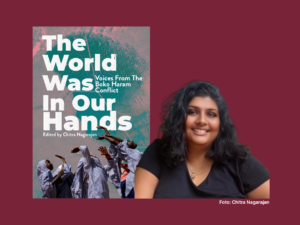Während bei Sozialem und Klima gekürzt wird, steigen weltweit die Ausgaben für Aufrüstung. Öffentliche Debatten sind von Militarisierung und Kriegsvorbereitung geprägt. ANDREEA ZELINKA erkundet dringend nötige feministische antimilitaristische Positionen.
Anfang dieses Jahres diskutierte ich in einem Workshop mit Schüler_innen, inwiefern sich das Patriarchat negativ auf Burschen auswirke. Prompt ging es um den Grundwehrdienst. Es waren nicht die Ausbildung an der Waffe und zur Verteidigung der Nation, die die Kids umtrieb. Hingegen sei es nur fair, wenn Frauen auch zum Wehrdienst verpflichtet würden. Kriegsdienstverweigerung bzw. Verweigerung des Wehrdienstes, der ja letztlich zum Kriegsdienst ausbildet, war überhaupt kein Thema. Und das, obwohl das Recht darauf erst 1987 von den Vereinten Nationen anerkannt wurde. Eine Reihe neuer Bücher wie „Für euch würde ich kämpfen. Mein Bruch mit dem Pazifismus“ oder „Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor“ und mediale Debatten beschwören die Bereitschaft herauf, im Ernstfall für das eigene Land in den Krieg zu ziehen. Antimilitaristische Positionen fehlen oder werden nicht ernst genommen. Wie sehr kann es da noch wundern, dass die Jugendlichen gar nicht an Verweigerung dachten, obwohl sie selbst direkt von Mobilmachung betroffen wären?
Harte Sparpolitik
„Es ist kein Zufall, dass wir in Österreich gleichzeitig Einsparungen in Gesundheit, Bildung und im Sozialbereich sehen, während Investitionen in Militär und Verteidigung erhöht werden“, sagt die Sozialwissenschafterin Anna Laetitia Rauchenwald in der Radiosendung „Militarisierung in der EU“ bei Globale Dialoge. Seitdem 2022 der damalige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ein paar Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine Zeitenwende ausrief, haben Militarismus und Kriegsvorbereitung verstärkt in europäische Politik und Gesellschaften Einzug gehalten. In Österreich heißt das, dass die ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung im Juni einen harten Sparkurs beschlossen hat, der fast alle gesellschaftlichen Bereiche trifft, jedoch nicht die militärische Aufrüstung. Österreich möchte 2025 noch 6,4 Mrd. Euro und 2026 weitere 8,7 Mrd. Euro einsparen, das vor allem bei Klima, Pensionen und Entwicklungszusammenarbeit. Für Klimaneutralität gibt es fast 2,7 Mrd. Euro weniger als 2024. Die Mittel für den Auslandskatastrophenfonds und die Austrian Development Agency wurden für 2025 und 2026 um 105,7 Mio. Euro gekürzt. In Zeiten zunehmender globaler humanitärer Krisen ein Kurs, der diese noch verschärfen wird. Zwar muss das Verteidigungsministerium auch sparen – 70 Mio. Euro in der Verwaltung –, doch bis 2032 sollen für Aufrüstung 17 Mrd. Euro zur Verfügung stehen, und das Verteidigungsbudget soll bis dahin auf 2 % des BIP erhöht werden.
Legitime Zweifel
Es handelt sich um einen europäischen Trend. Die Ukraine erhält von der NATO massive militärische Unterstützung, doch das meiste Geld fließt in die Aufrüstung der eigenen Streitkräfte. Deutschland hat unter Olaf Scholz ein Bundeswehr- Sondervermögen von 100 Mio. Euro geschaffen. Russische Bedrohungsszenarien und der Druck des US-Präsidenten Donald Trump auf die NATO bewog diese, heuer das Budget für Verteidigung und Sicherheit ab 2035 von 1,5 % auf jährlich 5 % des BIP zu erhöhen – so viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. „Da muss man schon die Szenarien der russische Bedrohung kritisch überprüfen“, sagt Rauchenwald.
In ihrer im Frühjahr erschienenen Studie „Wann ist genug genug?“ untersucht Greenpeace die weit verbreitete Annahme, die NATO wäre einer russischen Aggression unterlegen, und stellt das Gegenteil fest. NATO-Staaten geben schon jetzt zehnmal mehr für ihre Streitkräfte aus, in sämtlichen Waffensystemen übertrifft die NATO Russland mindestens um das Dreifache. Nur bei Atomwaffen herrscht ein strategisches Gleichgewicht. Für die NATO können 3 Mio. Soldat_innen und ein großes Reservoir an Reservist_innen in den Krieg ziehen, während es für Russland nur 1,33 Mio. Soldat_innen sind. „Aus diesen Zahlen ergibt sich keine Legitimierung für die Verdreifachung von Rüstungsausgaben, wenn jetzt bereits mehr ausgegeben wird als in Russland“, sagt Rauchenwald. Die weltweite Aufrüstungsspirale wird weiter angekurbelt, und das Geld fehlt in essenziellen sozialen und ökologischen Bereichen.
Repression von Antikriegsprotest
Derweil wird Antikriegsprotest delegitimiert, wie jüngst im August in Köln. Das Bündnis Rheinmetall Entwaffnen (RE) organisiert seit 2018 regelmäßig Aktionen gegen Aufrüstung und Rüstungsexporte sowie ein Camp. Erstmals wurde heuer von der Kölner Polizei versucht, das Camp und die Abschlussparade zu verbieten. Beides konnte stattfinden, allerdings kam es am 30. August während der Abschlussparade gegen den Krieg, organisiert von RE und dem Kölner Friedensforum, zu einem brutalen Polizeieinsatz. Die Polizei begründete dies mit Fehlverhalten von Teilnehmer_innen. Das Bündnis geht von einer gezielten Provokation und Störung des Antikriegsprotests aus.
Innerhalb von RE gibt es auch eine autonom-feministische Organisierung (Auto-Fem), in der sich FLINTA aus verschiedenen Frauen*Lesben-Gruppen, Antifa-Gruppen und internationalistischen Organisierungen zusammengeschlossen haben. Denn Kriegsproduktion ist nicht geschlechtlos. Militarismus ist eng mit patriarchalen Vorstellungen von Männlichkeit, männlicher Vorherrschaft und binärem Denken verbunden. Letzteres bezieht sich nicht nur auf Geschlechter, sondern auch auf ein Freund-und-Feind-Denken. „Diese Aufspaltung ist die Voraussetzung nicht nur für patriarchale Zuschreibungen, sondern auch für jede Form von Rassismus, Nationalismus und Abschottung, für Militarisierung und Krieg“, sagt Cora, Aktivistin bei Auto-Fem.
Wir und die anderen
Oft gehe es darum, sich entscheiden zu müssen, auf welcher Seite man stehe. „Etwa auf der Seite von palästinensischen oder israelischen Menschen“, erklärt Kerstin, ebenfalls Aktivistin bei Auto-Fem. Daher halten sie es mit Mona El-Tahawy. Die ägyptisch-US-amerikanische Journalistin und feministische Aktivistin rief zur Meuterei gegen das Patriarchat auf. „Die feministische Antwort auf Krieg ist Aufwiegelung und Verrat“, sagte sie und meinte damit, dem Patriarchat selbst den Krieg zu erklären, statt Kriege zwischen verschiedenen patriarchalen Staaten zu unterstützen. Ganz konkret bedeute es auch, Deserteur_innen sowie junge Menschen, die den Kriegs- und Wehrdienst verweigerten, zu unterstützen und das eigene Verhältnis zum Nationalstaat zu reflektieren. „Denn Desertieren bedeutet natürlich auch: du verrätst den Nationalstaat“, sagt Kerstin von Auto-Fem. Man müsse sich fragen, inwieweit man diese Politik mittragen wolle. Wie etwa auch bei der Diskussion, ob nun auch Frauen zum Wehrdienst verpflichtet werden sollten. „Das hat natürlich überhaupt nichts mit Gleichberechtigung zu tun“, sagt Kerstin. Militär und Krieg seien patriarchal und antifeministisch. „Krieg und Kriegsvorbereitungen sind die auf die Spitze getriebene Abwertung von allem, was in unserer Gesellschaft feminisiert ist“, sagt auch Rauchenwald.
Wo der Krieg beginnt
Doch eine feministische antimilitaristische Analyse geht über Krieg hinaus. „Gewalt findet nicht erst bei einem militärischen Angriff oder Feldzug statt, sondern ist bereits Normalzustand einer patriarchalen Gesellschaft. Frauenfeindliche Angriffe, Femizide, Vergewaltigung und sogenannte private Gewalt sind der unerklärte Krieg gegen Frauen“, erklärt Cora. Krieg und Besatzung verschärften patriarchale Gewalt, die im gesellschaftlichen Alltag bereits vorhanden ist. So werde Vergewaltigung von Frauen zu einer Kriegsstrategie. „Es kann diese Kriegswaffe nur geben, weil Vergewaltigung zum patriarchalen Alltag gehört. Ohne diesen Blick auf den Alltag und alltägliche staatliche Gewalt kann es keine Analyse von Krieg geben“, betont Cora. Diese Gewalt betrifft auch die Umwelt, wenn z.B. indigene Bevölkerung vertrieben und Lebensgrundlagen vernichtet werden, um das Amazonasgebiet zu roden und Rohstoffe zu fördern. „Das ist kein Krieg, der erklärt worden ist. Und trotzdem ist es ein Kriegszustand“, sagt Kerstin. „Eine feministische Perspektive auf antimilitaristische Politik verbindet soziale und ökologische Fragen, Geschlechterverhältnisse und Zuschreibungen, Gewalt gegen Frauen und Queers, die Hierarchisierung von Menschen und macht den Alltag zum Themenfeld unserer Politik“, ergänzt Cora.
Für universelle Abrüstung
Wie könnte also eine antimilitaristische Sicherheitspolitik aussehen? „Möglichst wenig für Rüstung ausgeben, die Profit- und nationale Logik durchbrechen und sich wirklich auf Verteidigung konzentrieren“, sagt Rauchenwald. Ein konkretes gesellschaftliches Ziel könne die Verankerung von Abrüstung und mehr demokratischer Kontrolle sein: „Wenn man sagt, die EU verpflichtet sich zur Abrüstung, gäbe es dann statt einer European Defense Agency eine Europäische Abrüstungsagentur“, so Rauchenwald.
Die älteste und heute noch existierende Friedensorganisation von Frauen, die Women‘s International League for Peace and Freedom (WILPF), forderte bereits 1915 universelle Abrüstung. In den Zwischenkriegsjahren schloss sie sich mit anderen Organisationen zum Disarmament Committee of Women‘s International Organisations zusammen. Gemeinsam forderten sie mit einer Petition internationale Abrüstung und sammelten weltweit insgesamt über 12 Mio. Unterschriften. Für WILPF ist dauerhafter Frieden nur durch soziale Gerechtigkeit gesichert. Da die Benachteiligung der Frauen Ungerechtigkeit bedeute, ist ein nachhaltiger Frieden ohne die Verbesserung des sozialen, ökonomischen und politischen Status der Frauen nicht möglich. Die Überwindung struktureller Ungleichheiten wurde zu einem zentralen Thema der Friedensbemühungen.
„Eine Frau, die in einer Partnerschaft lebt, in der sie jeden Tag gewalttätig behandelt wird, hat auch nicht das Gefühl, in Frieden zu leben“, sagt Kerstin heute. „Diese unterschiedlichen Zustände als Kriegszustände zu begreifen, macht irgendwann klar, was es bedeutet, tatsächlich in Frieden zu leben.“ Und Cora ergänzt: „Wenn Frauen in dieser Welt Freiheit erfahren, dann wird das Frieden für alle bedeuten.“
Andreea Zelinka ist Redakteurin der frauen*solidarität.