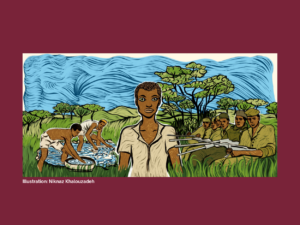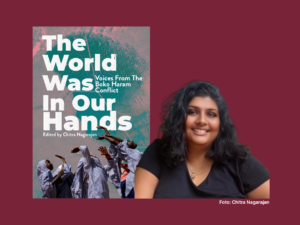Die Sahraoui leben seit der Besetzung der Westsahara durch Marokko dauerhaft in Geflüchtetenlagern. RAMONA SCHNALL hat mit Aktivist_innen über Widerstand, Resilienz und Hoffnung gesprochen.
Flimmernde Hitze, die auf Sandberge drückt. Rollende Dünen, die sich in den Horizont erstrecken, und Temperaturen, die im Sommer um die 50 Grad liegen. Die Wüste der westlichen Sahara im Süden Algeriens um Tindouf ist ein totes, unfruchtbares Land, eines, das sogar von nomadischen Beduinen gemieden wurde. Nichts scheint dort zu wachsen. Und doch, auf Google Maps findet sich neben dem Namen „Layoun Flüchtlingslager“ ein grüner Punkt. „Sogar die Satelliten sehen unseren Garten.“ Mir gegenüber am Screen sitzt Fatimatu, eine junge Frau, in einer gelben Kopfbedeckung, der traditionellen Melhfa, und ein stolzes Lächeln gekleidet, denn sie hat das Unmögliche vollbrach: Sie hat Leben in den Sand gesät. Fatimatu ist eine von den geschätzten 173.000 Sahraouis, die seit der Besetzung der Westsahara durch Marokko 1976 aus ihrem Land vertrieben wurden und seither in Zelten und erodierenden Häusern aus Sand in fünf Flüchtlingslagern leben.
Leben in den Camps
„Das Leben hier ist eine wirklich harte Erfahrung“, erzählt sie mir, im Hintergrund ist das Lachen ihrer Kinder zu hören. „Als ich geboren wurde, hat meine Mutter ein nasses Tuch über mich gelegt, um mich vor der Hitze zu schützen.“ Und weiter: „Früher war es noch härter. Wir hatten keine Elektrizität und mussten in die Wüste, um in der Nacht Wasser zu sammeln.“ Arbeit findet in den Camps fast niemand. Alles, was die Menschen zum Überleben brauchen, muss vom World Food Programme (WFP) und dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) geliefert werden. Trotz der Lebensmittelkörbe des WFP mit Weizen, Reis, Hefe und Linsen reichen die Nahrungsmittel kaum aus: 80 % der Sahraouis sind von Unterernährung betroffen. Vor allem Frauen, Schwangere und Kinder leiden darunter und an Folgekrankheiten wie Anämie. Wasser wird alle drei Monate in Plastik-Containern geliefert. Wenn die Container über Monate hinweg sengender Hitze ausgesetzt sind, kann das Trinken dieses Wassers Krebs verursachen. Viele in Fatimatus Umfeld sind betroffen. „Meine Großmutter starb an Krebs“, erzählt sie. „Mein Großvater auch. Jeden Tag höre ich von einer neuen Person, bei der Krebs diagnostiziert wurde.“ Für die medizinische Behandlung fehlt die Infrastruktur. „Jeder Tag in diesen Camps erinnert dich daran, dass du weniger Mensch bist als andere auf dieser Welt.“
Die letzte Kolonie
Der Grund für Fatimatus unfreiwilliges Leben in den Camps liegt in einer langen Kolonialgeschichte. Die Besonderheit: Westsahara ist im 21. Jahrhundert die letzte klassische Kolonie auf dem afrikanischen Kontinent. 1884 importierte das imperialistische Spanien ein kolonialistisches System in die Westsahara. In den 1960er-Jahren beschloss die UN mit ihrer Resolution 1514 zum Selbstbestimmungsrecht, dass Kolonialismus nicht mehr zur westlichen Vorzeigepolitik zählen sollte, infolgedessen habe jedes Land Recht auf Freiheit und die Achtung von Menschenrechten sowie Souveränität und Integrität des eigenen Territoriums. Ein Entschluss, dem sich die 1973 aus sahraouischen Student_innen gegründete Widerstandsbewegung, die Polisario-Front, anschloss. Ihr gelang es mit Unterstützung der UN, Spanien so unter Druck zu setzen, dass es schließlich die Kolonie Westsahara aufgab. Dabei hinterließ es ein Machtvakuum. Nur Stunden nach Spaniens Abzug marschierten Marokko und Mauretanien im Land ein. Diese Besetzung wurde 1979 vom Internationalen Gerichtshof als völkerrechtswidrig verurteilt. Motiviert durch diese Erklärung, gelang es der Polisario-Widerstandsbewegung, trotz deutlicher zahlenmäßiger und auch waffentechnischer Unterlegenheit, Mauretanien aus dem Territorium zu vertreiben. Gegen Marokko konnten die Guerilla-Kämpfer_innen jedoch weniger Erfolge verzeichnen, und so führte die Einigung auf ein von der UN organisiertes Referendum 1991 zu einem Waffenstillstand. Dieses versprach die Wahl zwischen einer marokkanischen Regierung und der Unabhängigkeit Westsaharas. Im Jahr 2025 warten die Sahraouis noch immer auf das Referendum.
Frauen im Widerstand
Doch überall, wo Repression und Terror regieren, sprießt auch Widerstand. Selbstverwaltete Bildungseinrichtungen, mit denen sich die Campbewohner_innen das Wissen aneignen, oder algerische, spanische und auch britische Bildungsinitiativen, die helfen, Kinder in Schulen in Algerien oder auf Universitäten in Spanien oder den USA zu schicken, sorgen dafür, dass auf der internationalen Ebene Sahraouis für Menschenrechte kämpfen. Die Camps verzeichnen gegenwärtig eine der höchsten Alphabetisierungsraten in Afrika. Dieser Erfolg ist auch den Frauen zu verdanken, die 80 % der Lehrerinnen ausmachen. Ali, Polisario-Vertreter in Hannover, wuchs selbst in den Camps auf und erinnert sich noch gut an die Rolle der Frau im Widerstand: „Ohne die Frauen hätten wir keines unserer Ziele erreicht. Sahraouis-Frauen sind vermutlich die wichtigste Säule unseres Kampfes.“ Dass Frauen heute die Rolle der Lehrerinnen einnehmen, geht auch auf die Gründung der Camps zurück. Die meisten Geflüchteten waren Frauen. Sie waren es, die Zeltstädte aufbauten und das Überleben der Sahraouis garantierten. Ihre Bedeutung ist heute noch in der Organisationsstruktur der Camps zu sehen.
„Ich glaube, dass die Sahraouis-Flüchtlingslager die einzigen Flüchtlingslager sind, in denen Frauen die Verteilung von Essen verwalten“, erklärt Oumima. Sie ist eine der Frauen, die Bildung auf die Bühne der UN-Generalversammlung geführt haben. Sie koordiniert eine Sahraouis-Frauengruppe, die für Freiheit, internationale Aufmerksamkeit und bessere Zustände in den Camps kämpft.
„Ich bin Aktivistin aus Versehen“, erklärt sie mir mit einem Lächeln. „Meine ältere Schwester war es, die zuerst bei der Polisario-Front war, weswegen wir aus Westsahara fliehen mussten.“ In Mauretanien, das Land, in das sie flohen, wurde ihr Vater ins Gefängnis gesperrt und das Haus der Familie zerbombt. Als sie in den Camps landeten, wurde ihr schnell die Rolle der Hoffnungsträgerin zugeschrieben, die später auf der internationalen Bühne für Gerechtigkeit kämpfen würde.
Mit der Wüste leben
Fatimatu wartet nicht auf Beschlüsse der UN, sondern widmet sich pragmatisch dem Jetzt. „Ich leiste Widerstand dadurch, dass ich in dieser Umgebung bin, in diesem Klima, weil ich hier überlebe. Ich leiste Widerstand mit unserem kleinen Projekt.“ 2023 rief Fatimatu Growing Hope ins Leben, nachdem bei ihr Anämie diagnostiziert wurde. Die Idee, die Heilung versprach: ein Garten in der Wüste. Früher war ein Großteil der Sahraouis Nomaden, die die Wüste lesen konnten, die mit Kamelen durch die Dünen zogen und von der Wüste lebten. Heute sieht Fatimatu das anders: „Die Wüste ist mein Todfeind. Ich glaube, die Wüste ist vermutlich das Tödlichste, das ich kenne: der verachtenswerteste Ort zum Leben.“ Doch auch wenn die Sahraouis um Tindouf heute nicht mehr von der Wüste leben, hatte Fatimatu die Idee, mit ihr zu leben. Wenn es möglich wäre, selbst Zwiebeln und Kartoffeln anzubauen, könnte man nicht nur Krankheiten vorbeugen, sondern auch unabhängiger von internationalen Geldgeber_innen werden. Auf Sand Zwiebeln und Kartoffeln zu pflanzen schien zunächst „verrückt“, wie Fatimatu beschreibt. Möglich machte es die Western Sahara Support Group aus Großbritannien, die Fatimatu als ihre zweite Familie beschreibt. Die NGO finanzierte Fatimatu ein Auslandsjahr in Manchester und unterstützt sie heute weiter mit finanziellen Mitteln, um die Samen, die Ausrüstung und den Polytunnel für das Gewächshaus in die Wüste zu transportieren.
Wurzeln schlagen
Am Anfang hatte Growing Hope mit der Wasserversorgung zu kämpfen: Wasser musste teuer eingekauft und per Lkws geliefert werden, etwas, das, wie Fatimatu erklärt, nicht unbedingt „nachhaltig“ ist. Dann wurde eine Quelle bei Layoun entdeckt, die in den 1980ern gegraben wurde, und das Projekt siedelte dorthin. Jetzt kann Fatimatu eine große Menge an verschiedenem Gemüse anbauen. „Letztes Jahr haben wir um die 40.000 Kilogramm Zwiebeln geerntet“, erzählt sie stolz. Heute wachsen auch Bäume im Garten. Doch Bäume stehen auch für das Schlagen von Wurzeln in einem Flüchtlingslager und damit auf den ersten Blick wie eine Kapitulation gegenüber Marokko. Fatimatu hat eine andere Sicht auf die Dinge: „Wenn du ein Kind bist, weißt du immer, dass du noch dieses andere Zuhause hast. In deiner Fantasie ist es der schönste Ort, wie ein Märchenland. Doch wenn du älter wirst, fängst du an zu begreifen, dass du für immer hier leben wirst und vermutlich auch hier sterben.“ Anstatt aufzugeben, gründete sie die Initiative Growing Hope. In der Zeit, in der man in der Wüste leben muss, kann man auch dafür garantieren, dass die Sahraouis durch eine Handvoll Gemüse überleben. Heute schafft der Garten fünf Festanstellungen und rund 20 Saisonarbeitsplätze. Fatimatu verkauft das Gemüse für solidarische Preise. Wenn jemand nicht die Mittel hat, erhält die Person das Gemüse auch umsonst. Stolz berichtet sie, wie sie immer mehr Menschen mit Saatgut und Rat für eigene kleine Gartenprojekte unterstützt: „Wir wissen ja auch nicht unbedingt, wie man Gemüse anbaut. Wir waren Nomaden. Aber wenn Menschen z. B. Probleme mit Insekten haben, helfen wir ihnen so gut es geht.“ Inzwischen, erzählt sie, sprießen überall im Camp Fatimatus Pflänzchen.
Gemeinschaft durch Gärten
In Manchester kam Fatimatu zum ersten Mal mit Gemeinschaftsgärten in Berührung. Heute sehnt sie sich danach, auch in der Wüste einen Rückzugsort zu schaffen, an dem Menschen, von Grün umgeben, entspannen können, wo Kinder spielen und lernen, Pflanzen zu pflegen. „Ich hoffe wirklich, dass ich eines Tages genug Geld dafür haben werde.“ Schon heute schafft sie es, einen Teil dieses Traums zu verwirklichen. „Alle sind glücklich, wenn sie in den Garten kommen. Manche kommen nur, um den Ort hier zu genießen, vor allem ältere Menschen.“ Und das ist vermutlich, neben gesünderer Ernährung und Unabhängigkeit von internationalen Hilfsorganisationen, der größte Erfolg des Gartens: „Er hilft, die Wüste zu vergessen, die Besetzung“, und damit auch, dass die Sahraouis in den Camps „weniger Mensch“ sein sollen als andere auf der Welt. „Der Garten gehört hier nicht hin. Er ist ein Außenseiter. Aber er gibt dir die Hoffnung, dass du diese Situation besiegen kannst“, erklärt sie mit Nachdruck. Anstelle eines Symbols der verblassten Hoffnung zu werden, wird Fatimatus Garten ihre Quelle.
Ramona Schnall ist freie Journalistin, die über Migrationspolitik, Grünen-Kolonialismus und europäischen Faschismus berichtet.