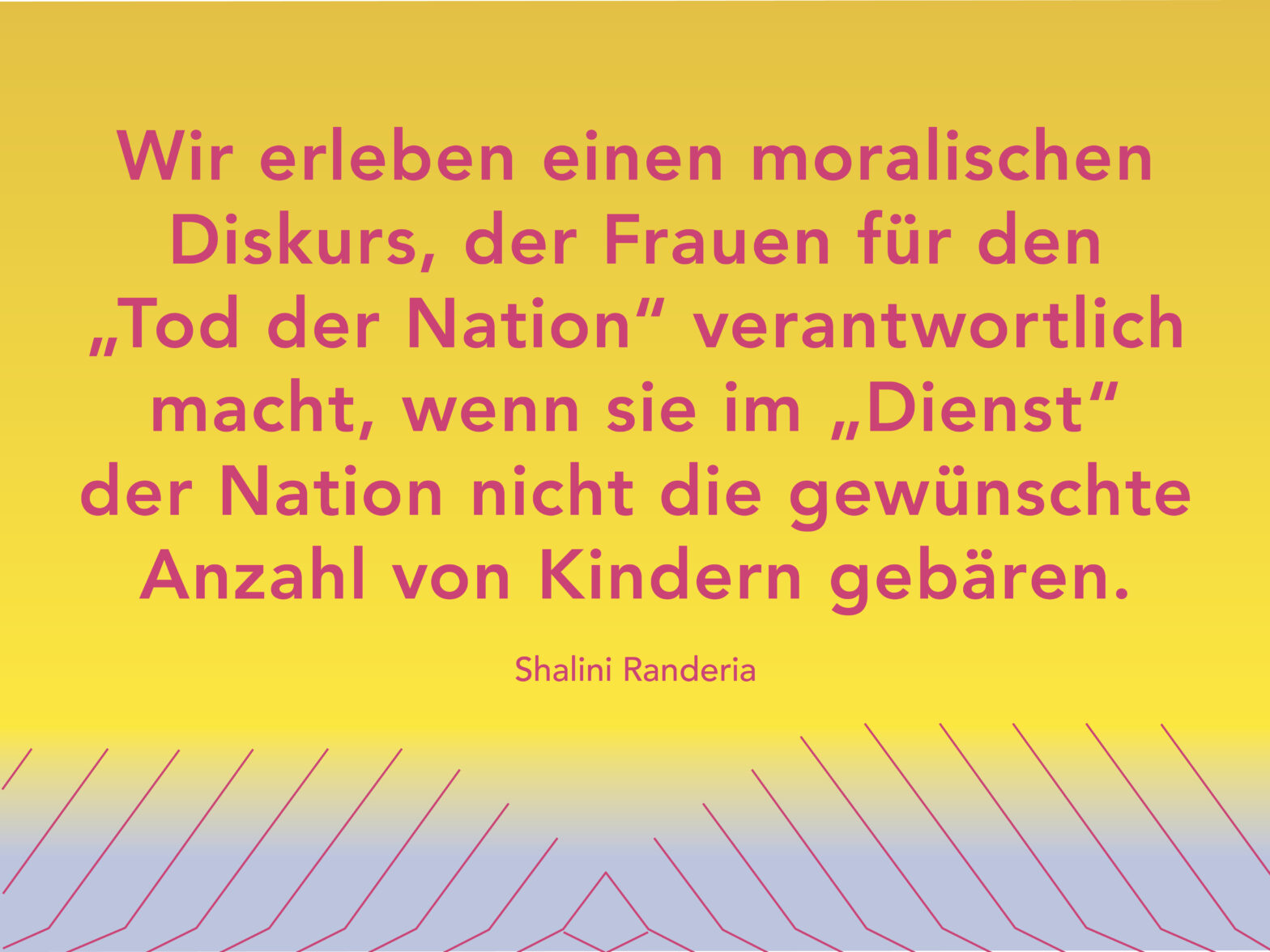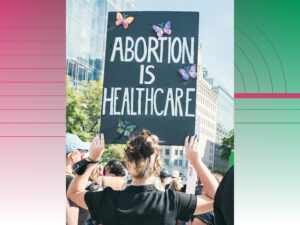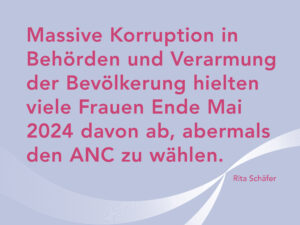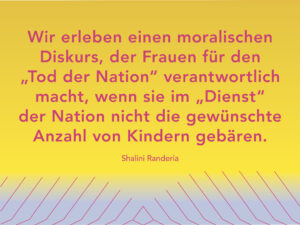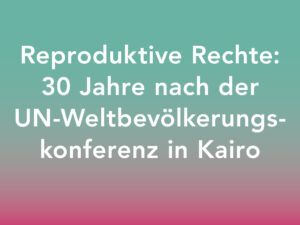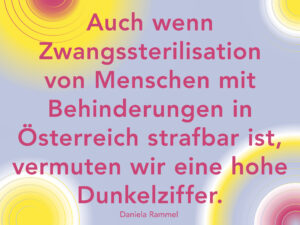In fast allen Teilen der Welt werden hart erkämpfte Frauenrechte massiv angegriffen. Rechtskonservative, nationalistisch-populistische, aber auch bürgerliche Parteien versuchen, das Selbstbestimmungsrecht von Frauen im Bereich der Reproduktion durch staatliche Eingriffe auszuhöhlen.
Frauenrechte und die reproduktive Autonomie von Frauen sind auch heute, 30 Jahre nach der UN-Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994, ein Privileg von nur wenigen Frauen in einigen Ländern der Welt. Migrant_innen, Geflüchtete und undokumentierte Arbeiter_innen werden in Bezug auf ihre Rechte, einschließlich ihrer reproduktiven Rechte, gänzlich anders behandelt als nationalstaatliche Bürger_innen. Trotz ihrer gesetzlichen Verankerung sind die vereinbarten Rechte in der Praxis unerreichbar, u. a. wegen eines mangelnden Zugangs zu medizinischer Versorgung.
Und selbst in jenen Ländern, in denen eine bessere Versorgung möglich ist, weigern sich konservative Ärzt_innen unter Berufung auf die eigene Gewissensfreiheit, Abtreibung, freiwillige Sterilisation und pränatale Untersuchungen sowie Unfruchtbarkeitsbehandlungen durchzuführen. Wie aber lässt sich rational begründen, dass der Gewissensentscheid eines Arztes eine größere ethische Legitimation erfährt als die Entscheidung einer Schwangeren? Zusätzlich erleben wir einen moralischen Diskurs, der Frauen für den „Tod der Nation“ verantwortlich macht, wenn sie im „Dienst“ der Nation nicht die gewünschte Anzahl von Kindern gebären.
Ethnonationalistische Panik
Rechtspopulist_innen schüren Angst vor sinkenden Geburtenraten der ethno-religiösen Mehrheiten und generell vor einer Zuwanderung „fremder“ ethnischer oder religiöser Migrant_innen. Für sie ist der Fortbestand der Nation gefährdet, wenn die Geburtenraten der ethnisch „reinen“ Mehrheitsbevölkerung, die das „wahre“ oder „authentische“ Volk bilden, sinken würden. Rechtspopulistische, aber auch konservative politische Strategien, die mit Panikmache den „Verlust im demografischen Wettbewerb“ propagieren, sind daher untrennbar miteinander verbunden. Allerdings verschleiert diese Argumentation, die sich als objektive Kalkulation der Größe und Zusammensetzung einer Bevölkerung ausgibt, die Tatsache, dass es nie eine natürliche Kontinuität in der Zusammensetzung einer Bevölkerung gegeben hat. Denn diese variiert stark durch Einwanderung und Auswanderung von Generation zu Generation und durch die Verschiebung nationalstaatlicher Grenzen. Letztlich ist es daher eine politische und keine demografische Frage, wer zu einer Nation gehört und wer als „fremd“ definiert wird.
Gesundheitsvorsorge, Bildung und Berufschancen
Für die Verwirklichung der reproduktiven Rechte von Frauen bedarf es einerseits der staatlichen Bereitstellung eines niederschwelligen, kostengünstigen Zugangs zu Gesundheitsversorgung und Bildung sowie andererseits eines gerechten Zugangs zum Arbeitsmarkt. Diese infrastrukturellen Bedingungen sind zwar notwendig, reichen allerdings bei weitem nicht aus, um eine hinreichende Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Ein Vergleich der skandinavischen Länder mit Südkorea oder Japan zeigt, dass sich bloße finanzielle Anreize oder wohlfahrtstaatliche Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenrate kaum auf den demografischen Wandel auswirken.
Die mangelnde Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt und ein nach wie vor unverändertes patriarchalisches Rollenverständnis hinsichtlich der Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung tragen wesentlich dazu bei, dass trotz jahrelanger staatlicher pronatalistischer Anreize Japan oder Südkorea eine sehr niedrige Fertilitätsrate aufweisen.
Ungarn als Negativbeispiel
Staatliche Versuche, das Bevölkerungswachstum durch finanzielle Anreize zu fördern, ohne die strukturellen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt oder traditionelle Geschlechterrollen zu verändern, sind daher zum Scheitern verurteilt. Nicht nur das: pronatalistische Politik erhöht zudem die Arbeitsbelastung und Benachteiligung von Frauen. Und sie dient einem antiliberalen ethno-nationalistischen Autoritarismus, der mit selektiven wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen patriarchalische Werte und traditionelle Geschlechterrollen verfestigt.
Das zeigt sich etwa in Ungarn. Dessen antiliberale soziale und politische Agenda zielt direkt auf Geschlechterbeziehungen genauso wie auf häusliche und Lohnarbeit von Frauen ab. Die Politik des Orbán-Regimes möchte mit einer Mischung aus ethno-nationalistischem Pronatalismus und paternalistischer populistischer Familienpolitik eine Neugestaltung von Geschlechterrollen und -beziehungen erreichen. Wie Eva Fodor zeigte, dient der Appell an eine scheinbar kulturell einzigartige und homogene ungarische Bevölkerung dem Regime Orbáns dazu, die real vorhandenen wirtschaftlichen und sozialen Konflikte zu verschleiern. Stattdessen zielt Orbáns fortdauernder Angriff auf eine angebliche internationale „Gender-Lobby“ darauf hin, jegliche Forderung nach einer liberalen, pluralistischen Gesellschaft als „nicht-ungarisch“ zu diskreditieren. „Gender“ wird zudem politisch angegriffen, um die Belastung von Frauen durch unbezahlte Pflege- und Sorgearbeit zu steigern und dadurch eine größere Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu legitimieren. Wie der ungarische Minister für Humanressourcen 2021 sagte: „In der Familie und in der Gesellschaft verkörpern Frauen Sanftmut, Hingabe, Fürsorge, Empathie, Schönheit“ – allesamt weibliche Stereotype, die mit traditionellen Rollenbildern verbunden sind. Die gesamte Last der unbezahlten häuslichen Arbeit und Pflege soll auf Frauen abgewälzt werden. Steuervergünstigungen, „Babydarlehen“, günstige Hypotheken und andere Subventionen in Ungarn sind allerdings an bezahlte Beschäftigung gebunden. Diese politischen Anreizstrukturen sowie die Regierungspropaganda über die „natürliche“ Fürsorgepflicht von Frauen, das Fehlen durchsetzbarer Gleichstellungsmaßnahmen am Arbeitsplatz und schwache Gewerkschaften, die sich mit Geschlechterfragen kaum befassen, verschärfen die benachteiligte Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
Reproduktive Freiheit
Wir erleben aber nicht nur in Ungarn, sondern weltweit eine Politisierung demografischer Zahlen mit dem Zweck, Frauenrechte, reproduktive Rechte wie auch Rechte von Minderheiten einzuschränken oder gänzlich abzubauen. Durch gezieltestaatliche Maßnahmen wird ihre körperliche Autonomie sowie Entscheidungsfreiheit massiv eingeschränkt.
2022 wurde in den USA durch die Entscheidung des konservativ dominierten Supreme Court das 1973 liberalisierte, für alle US-Staaten geltende Abtreibungsrecht aufgehoben. Erneut sind die einzelnen Bundesstaaten für gesetzliche Vorgaben zum Schwangerschaftsabbruch zuständig – was vor allem in den Südstaaten de facto zu einer Aufhebung des Zugangs zu legalen Abtreibungen geführt hat. Während vor 50 Jahren in dem Prozess Roe v. Wade Frauen „das Recht auf Privatsphäre“, d. h. auf selbstbestimmte Entscheidungen, zugesprochen wurde, erleben wir heutzutage eine erneute Instrumentalisierung von Sexualität und reproduktiven Rechten für ultrakonservative, nationalistische politische Zwecke. Vor dem Hintergrund einer öffentlich geschürten Panik vor der „Explosion“ der Bevölkerung im globalen Süden und einer schrumpfenden „weißen“ Bevölkerung im globalen Norden, werden die weitreichenden Beschlüsse der Konferenz von Kairo zur sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung sukzessive aufgehoben. Das Urteil des US-Supreme Court veranschaulicht diese Entwicklung der langsamen, aber systematisch betriebenen Umgestaltung liberaler Demokratien hin zu einem „sanften Autoritarismus“.
Mit Bezug auf Religion und Moral sowie nationalistische Geschichtsdeutungen nehmen Gerichte und Gesetzgebung eine zentrale Rolle im schleichenden Prozess des Abbaus von Frauenrechten ein. Das wird als „lawfare“ beschrieben, als Kriegsführung mittels Gesetzen und Gerichten gegen liberale Werte und Institutionen. Dabei wird „rule of law“ durch „rule by law“ ersetzt. Ironischerweise wird von konservativen Kräften ein Rückzug des Staates in allen gesellschaftlichen Sphären gefordert, während parallel dazu staatliche Interventionen bei Frauenrechten umgesetzt werden.
Ökonomische Rahmenbedingungen
Die zukunftsweisenden Beschlüsse der Konferenz in Kairo haben für Frauen des globalen Nordens wie Südens gleichermaßen das Recht auf Zugang zu Bildung, eine selbstbestimmte Sexualität und Fruchtbarkeit, die umfassende Teilhabe auf allen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ebenen gesellschaftlicher Entwicklung als verbindliches Leitbild formuliert. Im Rückblick darauf ist es heute dringend notwendig, auch die makrostrukturellen Bedingungen, unter denen die Rechte der Frauen gefährdet sind, im Auge zu behalten.
Wenn z. B. die Geburtenraten in Polen oder Italien in jüngster Zeit auf den niedrigsten Stand in Europa gesunken sind, zeigt dies, dass wirtschaftliche Umstrukturierungen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschweren, nachhaltig die individuellen Handlungsspielräume und Entscheidungen von Frauen beeinflussen. Die neoliberale Umstrukturierung sowohl im Norden als auch im Süden wirkt sich unverhältnismäßig stärker auf Frauen negativ aus, da deren Arbeit prekär wird. Budgetkürzungen und Privatisierungen in der Kinderbetreuung, im Gesundheitswesen und in der Altenpflege führen dazu, dass alle diese Dienste teurer werden, weniger zugänglich sind und somit die Belastung für Frauen steigt – da gesellschaftliche Aufgaben zu privaten Pflichten umgedeutet werden. Jede reproduktive Steuerung, ob antinatalistisch oder pronatalistisch, umgesetzt durch Zwang oder Propaganda, durch Gesetze oder Gerichtsentscheidungen, finanzielle Anreize oder Steuervergünstigungen, beschneidet die reproduktive Freiheit von Frauen. Ähnlich wie die staatliche Bevölkerungskontrolle zur Senkung der Fruchtbarkeit in Ländern des globalen Südens, gegen die auf der UN-Konferenz in Kairo die transnational vernetzte Frauenbewegung ihre Stimme erhoben hatte, gefährden heute auch pronatalistische Maßnahmen die reproduktive Freiheit von Frauen. Es handelt sich dabei um eine Einmischung in die intimste persönliche Sphäre.
Daher ist erneut eine breite Allianz erforderlich, die kollektiven Widerstand leistet. Nicht nur die liberale Demokratie, sondern auch Frauenrechte benötigen ständigen Schutz.
Zur Autorin: Shalini Randeria ist Rektorin der Central European Universität, Wien.