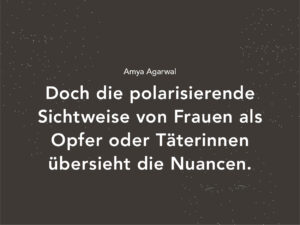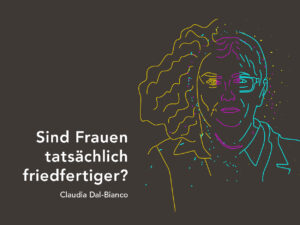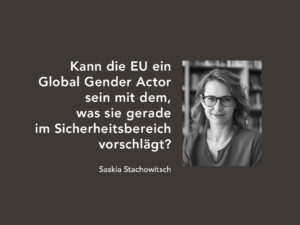„Frauen, Friede und Sicherheit“ im Kosovo
Die schrecklichen Bilder des Krieges in der Ukraine haben schon überwunden geglaubte Kriegstraumata im Kosovo wiederaufleben lassen. Zu ähnlich ist die Situation: ein großer Nachbar, der einmarschiert, die Zivilbevölkerung ermordet und Vergewaltigungen von Frauen als Kriegswaffe einsetzt. Welche Erfahrungen können kosovarische Aktivistinnen Frauen in der Ukraine und anderen Konfliktgebieten weitergeben?
„Wir haben die UNO-Sicherheitsratsresolution 1325 vom ersten Tag an als unser Werkzeug genutzt“, erzählt Igballe Rogova1, Aktivistin seit mehr als 30 Jahren, Mitbegründerin und langjährige geschäftsführende Direktorin des Kosovo Women’s Network (KWN). Die Resolution zu Frauen, Frieden und Sicherheit wurde im Jahr 2000 beschlossen, unmittelbar nach den Kriegsvergewaltigungen in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo. 1325 – so die Kurzbezeichnung – verlangt Gerechtigkeit und Entschädigung für sexuelle Gewalt wie auch die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen an Entscheidungen im (Post-)Konflikt-Kontext. Als der Krieg 1999 zu Ende ging, erwarteten kosovarische Frauenrechtsorganisationen, dass die UNO-Interimszivilregierung (UNMIK) die Menschenrechte und Prinzipien der Geschlechtergleichstellung der Frauenrechtskonvention (CEDAW) fördern, anwenden und ihre Stimmen hören würde.
Hoffnung auf Mitbestimmung
Denn sie wollten den Kosovo (wieder-)aufbauen. Während der massiven Unterdrückung durch das serbische Milošević-Regime in den 1990ern waren u. a. albanischsprachige Schulen geschlossen und albanische Bücher verbrannt worden. Damals mobilisierten Frauen und Männer gemeinsam Gesundheits- und Bildungsstrukturen sowie humanitäre Hilfe. Immer wieder konnten Frauen, weil sie Frauen waren, sich sicherer bewegen und gingen deshalb größere Risken als Männer ein. Damit z. B. Kinder, vor allem Mädchen, ihre Ausbildung fortsetzen konnten, brachten sie ihnen verbotene albanische Bücher. „Wir hatten in den 1990ern sehr starke weibliche Führungskräfte in Politik wie Zivilgesellschaft“, erzählt Rogova. Fast ein Jahrzehnt lang leiteten diese große Teile des friedlichen Widerstands sowie der internationalen Lobby-Arbeit. „Aber nach dem Krieg kam UNMIK, deren Führung war dominiert von Männern aus dem Militär. Sie schoben die Frauen weg, denn jetzt waren sie die Experten. Sie waren mit (Nach-)Kriegssituationen bestens vertraut und glaubten deshalb, genau zu wissen, wie Konflikte anzugehen wären“, berichtet Rogova. Gegen diese neokoloniale Herangehensweise „brachten wir mit Hilfe der Resolution 1325 Frauen in Entscheidungspositionen“, erinnert sie sich. Im Buch des Kosovo Women’s Network 1325 Facts & Fables2 gibt es dazu zahlreiche Beispiele.
Keine Sicherheitsnetze
Leider ist in 1325 keine Rechenschaftspflicht für sexuelle Gewalt gegen Frauen verankert. Schätzungsweise waren mehr als 20.000 Frauen während des Kosovo-Krieges sexueller Gewalt ausgesetzt. Gleich nach dem Krieg schilderten Hunderte von ihnen UNMIK die erlittenen Vergewaltigungen, unterstützt von Aktivistinnen. „Und dann verschwanden diese Aussagen“ berichtet Rogova. „Danach hielten die Frauen den Mund. Sie waren isoliert, es gab keine sozialen und wirtschaftlichen Sicherheitsnetze. Wir mussten mit jeder einzelnen Frau arbeiten, mit ihnen Zeit verbringen, mit ihnen weinen.“
We shall overcome
„Wir respektierten ihr Schweigen, viele Jahre lang. Aber gleichzeitig arbeiteten wir mit ihren Familien und Nachbar_innen gegen das gesellschaftliche Stigma ihnen gegenüber“, erinnert sich Rogova. 2012 war es Zeit, das Schweigen zu durchbrechen. KWN und andere Aktivist_innen wählten für den 8. März das Motto: „Wir wollen keine Blumen. Wir wollen Gerechtigkeit für die Überlebenden der Vergewaltigungen im Krieg.“ Und sie schrieben einen eigenen Text zum berühmten US-Bürgerrechts-Lied „We shall overcome“ und sangen es gemeinsam. Wie „Engelsstimmen“ klang das bis ins Regierungsgebäude in Prishtina und rührte sogar dort viele zu Tränen. Dieser Protest war mit Politikerinnen vorbereitet worden. Am Tag danach thematisierte der parlamentarische Frauen-Caucus das Thema im Parlament – und öffnete die Tür zur Diskussion über Rechtsschutzmaßnahmen. Aber es gab Vorbehalte: Einige Parteien, Regierungsmitglieder und Veteranen wollten Vergewaltigungs-Überlebende nicht im „Veteranen“-Gesetz verankert sehen, die ersten Gesetzesänderungen scheiterten. „Aber die überlebenden Frauen wollten kein eigenes Gesetz, und wir hörten auf sie“, erinnert sich Rogova.
Großer Erfolg: Überlebende inkludiert
Auch Staatspräsidentin Atifete Jahjaga, die erste Präsidentinin der gesamten Region, hörte auf sie. Gemeinsam mit ihr lobbyierten die Aktivistinnen Abgeordnete und politische Parteien, damit sie den Überlebenden endlich zuhörten. Präsidentin Jahjaga war die erste Führungsperson im Land, die sich mit im Krieg vergewaltigten Frauen traf. Sie rief den Nationalen Rat für Überlebende von Sexueller Gewalt im Krieg ins Leben und versammelte darin das Kabinett des Premiers, Minister_innen, Polizei, Justiz und internationale Zivilgesellschaft. Auch in diesen Ratstreffen verwendeten Aktivistinnen die Resolution 1325 als Werkzeug.
„Es war die rechtliche Grundlage für unsere Forderungen“, sagt Rogova. Nach intensiven Debatten wurde das relevante Gesetz 2014 endlich novelliert und inkludiert seitdem die Überlebenden. Die Aktivistinnen unterstützten die Regierung bei der sorgsamen Ausformulierung von Mechanismen, mit denen die Frauen um Zahlungen und andere Leistungen ansuchen können, ohne zusätzlich stigmatisiert zu werden. Und sie wählten sensible Personen als Mitglieder der Antragsprüfungskommission aus. Bis jetzt haben mehr als tausend Überlebende Entschädigungszahlungen und andere Leistungen erhalten.
Verwendet 1325 als euer Werkzeug!
Die Geschichte ist nicht vorbei. Derartige Prozesse dauern Jahre. Deshalb wird weiterhin daran gearbeitet, dass es für Antragstellungen keine Frist mehr gibt. Welchen Rat würde Rogova Frauenrechtsaktivistinnen in heutigen Kriegsgebieten geben? „Unterstützt vom ersten Tag an die Überlebenden der sexuellen Gewalt. Schaut, dass sie alles bekommen, was sie brauchen: psychologische und medizinische Betreuung, wirtschaftliche Unterstützung – und kümmert euch um sie. Und setzt euch gleichzeitig für Gerechtigkeit und Entschädigungszahlungen ein. Wartet nicht wie wir im Kosovo – denn UNMIK hat uns im Stich gelassen. Verwendet 1325 als euer Werkzeug!“
Anmerkungen:
1 Dieser Artikel basiert auf einem Interview mit Igballe Rogova. Er verwendet feministische Oral History-Methodologie, nach der sie Autorin ist.
2 KWN, Facts & Fables. Das Buch wurde von der Austrian Development Agency ADA finanziert und von der NATO für die Ausbildung von Friedenstruppen verwendet.
Zu den Autorinnen:
Igballe Rogova,weltweit anerkannte Frauenrechtsaktivistin, begann ihre friedensschaffenden Bemühungen schon in den 1990ern. 2006 war sie eine der Gründerinnen der kosovo-serbischen FrauenFriedensKoalition. Sie war Mitglied der High-Level Advisory-Gruppe für die UN Global Study on UNSCR 1325 und des NATO Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security.
Nicole Farnsworth ist Programmdirektorin bei KWN und Co-Autorin von 1325 Facts & Fables. Seit knapp 20 Jahren hat die Frauenrechtsaktivistin Dutzende von Analysen zur Geschlechtergleichstellung im Kosovo veröffentlicht. Außerdem berät sie internationale Organisationen zur Umsetzung von 1325.