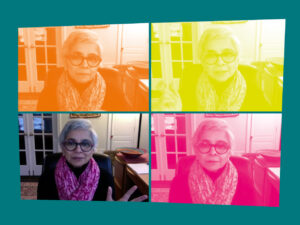Sollen feministische Bewegungen global, international oder transnational sein? Oder doch lieber lokal? Claudia Dal-Bianco hat die feministische Soziologin Manisha Desai über Ursprünge und Veränderungen feministischer Bewegungen befragt.
Existiert globaler Feminismus?
Manisha Desai (MS): Ich denke, das hängt davon ab, was man unter global versteht. Wenn mit global eine einzige Bewegung gemeint ist, dann ist das weder möglich noch wünschenswert. Wenn mit global gemeint ist, dass es überall auf der Welt feministische Bewegungen gibt, dann ist das die Realität. In diesem Sinne sind Feminismen globale Bewegungen.
Begriffe wie Transnationalität, Diversität oder Intersektionalität prägen feministische Diskussionen. Auch von international, global und transnational ist die Rede. Was verbirgt sich hinter den einzelnen Begriffen?
MS: Wenn man historisch denkt, gab es internationale und transnationale Bewegungen seit über einem Jahrhundert. Das Konzept des transnationalen Feminismus entstand in den 1990er Jahren an US-amerikanischen Universitäten.
Internationaler Feminismus kommt aus dem UN-Kontext. 1975 rief die UNO das Internationale Frauenjahr aus. 1975 bis 1985 war das internationale Frauenjahrzehnt, und das Jahrzehnt zwischen 1985 und 1995 ist durch die 4. UN-Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 in Erinnerung geblieben. Der Begriff wurde anfangs von Feministinnen aus dem globalen Norden verwendet, um über Solidarität unter Frauen aus allen Ländern zu sprechen.
Global ist ein Konzept aus den 1960er Jahren. Robin Morgan war die erste, die von „globaler Schwesternschaft“ sprach. Der Gedanke, dass die feministische Bewegung universell sein muss, um das Patriarchat, das universell ist, zu stürzen, hat ihren Ursprung in weißen feministischen Bewegungen im globalen Norden. Er entspringt der Vorstellung, dass Frauen überall unterdrückt werden. Dabei wurden jedoch die Unterschiede aufgrund von Klasse, race, Religion und anderen Unterschieden nicht erkannt.
Wenn man über Intersektionalität nachdenkt, ist der Begriff relativ neu, und er wird Kimberley Crenshaw in den 1990er Jahren zugeschrieben. Aber Leute wie Sojourner Truth sprachen im 19. Jahrhundert in den USA bereits über race, Klasse und Geschlecht. Sozialistische Frauen haben großen Anteil daran, dass Geschlecht und Klasse in die Diskussion mit eingebracht werden. In gewisser Weise haben also nicht alle nur über Geschlecht gesprochen. Aber die Globale Schwesternschaft hat Frauen mit all ihren Unterschieden in eine Kategorie gepackt.
Es ist eine große Stärke der feministischen Bewegungen, sowohl der intellektuellen als auch der aktivistischen, dass wir sehr unnachgiebig sind. Wir sind kritisch gegenüber unseren eigenen Unzulänglichkeiten und bereit, uns zu ändern und zu öffnen. Alle von mir genannten Begriffe spiegeln einen Teil dessen wider, was Feministinnen wirklich tun, nämlich auf Kritik zu hören und offen für ein Umdenken zu sein.
Wie kann Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden?
MS: Schon 1975 bei der Weltfrauenkonferenz in Mexiko gab es große Spannungen darüber, dass die Schwesternschaft nicht global ist und sich die Erfahrungen von Frauen in Indien sehr von denen in den USA unterscheiden. „Entwicklung“ wurde auch zu einem sehr umstrittenen Begriff, denn manche Länder wurden im Laufe der Zeit „unterentwickelt“ gemacht. Es gab Probleme mit Armut, mit Kolonialismus, mit Rassismus, und so traten all diese strittigen Themen in den Vordergrund.
1980 wurde die Konferenz nach Kopenhagen verlegt, und es gab viele Differenzen zum Thema Sexualität. 1985 fand die Konferenz in Nairobi statt. Damals war es das erste Mal, dass Frauen aus den verschiedenen Ländern, auch wenn sie sich gegenseitig hinterfragten, kritisierten und herausforderten, erkannten, dass es auch Gemeinsamkeiten gibt – dass es wahr ist, dass Frauenprobleme überall anders sind, aber es auch wahr ist, dass Frauen überall Gewalt erfahren und patriarchalem Kapitalismus ausgesetzt sind.
Das war ein wichtiger Moment, der durch die UN-Weltfrauenkonferenzen passierte: Unterschiede existieren, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten und Solidarität. Das ist meines Erachtens eine wichtige Verschiebung. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass es nicht nur um Identität gehen kann, sondern auch um ein politisches Projekt.
Manche denken über Solidarität nach, über die Unterschiede und darüber, wie Kolonialismus und Globalisierung einbezogen werden kann. Die Globalisierung war etwas, das die Brüche unter Feministinnen gezeigt hat. Denn es gibt privilegierte Feministinnen. Ein gutes Beispiel ist der neoliberale Feminismus, der besagt, dass Frauen die gleichen Chancen wie Männer erhalten sollten.
Jetzt haben wir den Feminismus der 99 Prozent, in Indien nennen wir ihn Bojan-Feminismus, was der Feminismus der Mehrheit der Frauen sein soll. Sie wollen nicht Teil des neoliberalen Projekts sein, weil es ein kapitalistisches Projekt ist und tatsächlich auf der geistigen Ausbeutung einer Gruppe von Menschen gegenüber einer anderen beruht. Es ist wichtig, das neoliberale Projekt im Auge zu behalten. Wenn es nur um Gender geht und nicht um soziale Gerechtigkeit im Allgemeinen, dann kann es sein, dass Feministinnen, wie sie auf Social Media zu sehen sind, über Dinge reden, die für die meisten Frauen kein Thema sind.
Sie haben über die Weltkonferenzen in der Geschichte der Frauenbewegung gesprochen. Die letzte war 1995 in Peking. Wo sind heute die Räume, in denen diese Art von Diskussion stattfindet?
MS: Sie findet jetzt in verschiedenen Räumen statt. Viele von uns waren fast zehn, 15 Jahre an den Weltsozialforen beteiligt. Das erste war 2001 in Brasilien. Einerseits sind die Probleme global, wir wollen Solidarität über Grenzen hinweg – wir wollen also einen transnationalen Feminismus. Andererseits bedeutet das Zusammenkommen auf globaler Ebene oder in einem großen Kontext, dass nicht alle Leute teilnehmen können. So reproduzieren wir gewissermaßen die Ungleichheit zwischen denen, die dabei sein, und denen, die nicht anwesend sein können. Der Schwerpunkt liegt auf der Finanzierung all dieser Konferenzen.
Das letzte Weltsozialforum fand 2017 in Marokko statt. Dazwischen waren sie überall auf der Welt, in Indien, in Afrika, es sollte global sein. Es wurde zu einem wichtigen Ort, an dem Feministinnen aus vielen Ländern zusammenkamen. Feministinnen riefen vor dem Forum den Feminist-Dialog ins Leben, um die Marginalisierung von Frauen und Frauenthemen auf den Weltsozialforen zu bekämpfen, obwohl die Mehrheit der Teilnehmer_innen Frauen waren1.
Ich denke, was wir jetzt haben, sind transnationale Multi-Skalen-Feminismen – lokal, national und regional –, die sich gegenseitig beeinflussen. Wir haben andere Räume, die entstanden sind. Die globale Vision bedeutet, dass man über Grenzen hinweg arbeiten kann, was wunderbar ist. Aber was lokal und regional passiert, darf dabei nicht beeinträchtigt werden. Letztendlich leben die meisten von uns lokal, an einem bestimmten Ort, selbst diejenigen, die ständig in der ganzen Welt unterwegs sind.
Wir brauchen eine bessere Artikulation zwischen den verschiedenen Arten von Feminismen. Die Corona-Pandemie führte u. a. dazu, dass die Menschen nicht mehr reisen oder zu Konferenzen fahren konnten. Durch die Digitalisierung der Konferenzen hat sich die Situation ein wenig demokratisiert. Wir wissen aber auch, dass der Zugang zum Internet nicht überall verfügbar ist.
Für mich ist transnational nicht nur eine grenzüberschreitende Bewegung; man kann eine völlig lokale Basis haben und trotzdem eine transnationale Bewegung sein, weil die Art und Weise, wie man über lokale Themen denkt und sich mit anderen verbindet, nicht unbedingt persönlich, aber intellektuell und politisch, den Transnationalismus beeinflusst. Aber für mich findet Transnationalismus auch auf mehreren Ebenen statt. Es geht nicht unbedingt um ein länderübergreifendes Netzwerk. Es könnte ein lokales Netzwerk sein, das von transnationalen Diskursen und Ideen geprägt ist.
Gibt es ein Beispiel dafür?
MS: Gerade gestern habe ich den Bericht von Akshara2 bekommen. Es handelt sich um eine Frauenorganisation in Bombay, die sich für eine Gesellschaft einsetzt, die frei von Gewalt gegen Frauen ist und in der sie uneingeschränkt mitwirken können. Der Bericht „Schattenpandemie“ zeigt, was mit den Frauen während der Corona-Pandemie geschah. In ihren lokalen Berichten verwenden sie Begriffe und Konzepte, wie wir sie in den USA verwenden, oder vielleicht auch in Österreich, wie Intersektionalität. Vieles von dem, was sie denken oder schreiben, ist sowohl von der lokalen als auch von der transnationalen Ebene beeinflusst.
Was sind Ihrer Meinung nach Fallstricke transnationaler Vernetzung? Gibt es welche?
MS: Viele Wissenschaftler_innen haben darüber geschrieben. Es gibt – wenn man so will –drei große Fallstricke.
Erstens den Fokus: Wenn man sich stark auf transnationales Networking konzentriert, braucht man Ressourcen. Denn selbst wenn man nicht reist und Vernetzung hauptsächlich online betreibt, braucht man viel Zeit und Ressourcen für das, was man tut. Die Verlagerung des Schwerpunkts vom Lokalen zum Transnationalen beeinträchtigt die lokalen Bemühungen und die Arbeit, weil die dann zu kurz kommen.
Der zweite Punkt ist die Finanzierung: Woher kommen transnationale Netzwerke? Aus der Mittelschicht, von Fachleuten. Es existiert eine große Debatte zwischen Bewegungen, die an der Basis entstanden sind, und professionellen Organisationen, die dann zu materiellen Bewegungen, zu Nichtregierungsorganisationen wurden. Das führt dazu, dass ein großer Teil der Zeit und Energie darauf verwendet wird, Gelder zu bekommen.
Der dritte Fallstrick ist die Übertragbarkeit: Wir können zwar immer von anderen Orten lernen und unsere eigenen lokalen Erfahrungen weitergeben, aber nicht alles wird sich übertragen lassen. Unser Projekt als Feministinnen ist es, nicht nur die Geschlechterhierarchien und -strukturen zu untergraben, sondern auch den strukturellen Rassismus, die strukturelle Ungerechtigkeit, die Ungleichheit – das ist die gemeinsame Vision. Was das dann in den verschiedenen Kontexten bedeutet, variiert aufgrund der unterschiedlichen Geschichte und der Stellung in der aktuellen geopolitischen Realität.
Bei der Suche nach den eigenen Rechten müssen wir auf die Rechte von anderen achten. Das ist eine große Diskussion der dekolonialen Bewegung. In Nordamerika ist das gerade ein großes Thema, denn wir sind eine Siedler_innenkolonie, die nie dekolonisiert wurde. In Indien hingegen gab es einen postkolonialen Moment.
Gerade was Postkolonialität angeht, sind Chandra Mohanty und Gayatri Spivak bekannte Wissenschaftlerinnen, die die internationalen feministischen Debatten geprägt haben. Sie haben insbesondere westliche Feministinnen kritisiert und neue Perspektiven in die Debatte eingebracht. Beide, wie auch Sie, kommen aus Indien – ist das ein Zufall, oder hat das etwas mit Indien zu tun?
MS: Ich glaube, das ist kein Zufall. Postkoloniale Feministinnen, mich eingeschlossen, haben eine spezielle Erfahrung. Aber wir sind auch alle privilegiert. Aber niemand von uns hat wirklich über den indigenen Feminismus in den USA gesprochen. Wir haben über race und Postkolonialismus gesprochen, aber wir haben nicht darüber gesprochen, was die Siedler_innenkolonialität in den USA für unsere eigenen Erfahrungen als Immigrantinnen bedeutet.
Weder Mohanty noch Spivak haben die Frage der Kaste und der Indigenität in Indien in den Mittelpunkt gestellt. In Indien ist der Feminismus in einen autonomen Feminismus gespalten, der heute oft als Savarna-Feminismus bezeichnet wird. „Savarna“ ist die Bezeichnung für die oberen Kasten. Die meisten Feministinnen identifizieren sich nicht als Savarna, werden aber von Dalit- oder Bahujan-Feministinnen als solche bezeichnet. Aber so problematisch die Kastenhierarchie auch ist, diese Normen existieren und formen uns. Auch diese blinden Flecken müssen benannt und angegangen werden.
Identitätspolitik kann aber nicht die einzige Antwort sein. In den USA sprechen wir von Cancel-Culture. Man macht irgendeinen Fehler, indem man nicht erkennt oder nicht den richtigen Begriff oder das richtige Konzept verwendet, und dann wird man annulliert. Dasheißt, das, was man sagt, wird auch zukünftig nicht mehr gehört. Wir sind alle Teil derselben Erde, wir müssen wirklich in planetarischen Begriffen denken und nicht nur in Begriffen der Identität.
Wie sieht die Zukunft von feministischen Bewegungen aus?
MS: Feministische Bewegungen verfügen über ausreichend Infrastruktur, sowohl intellektuell als auch aktivistisch, sodass wir, egal um welches Thema es sich handelt, einen feministischen Blickwinkel darauf haben. Wir haben derzeit drei große Krisen: globale Ungleichheit, Klimawandel und Covid. Feministinnen haben zu all diesen Themen viel geschrieben und sich damit auseinandergesetzt, weil wir dazu neigen, offen zu sein und größere soziale Gerechtigkeit im Auge zu behalten. Wir denken über Komplexität nach. Ich bin hoffnungsvoll, obwohl ich all die Probleme sehe. Vor allem die jüngere Generation neigt dazu, intersektional und planetarisch zu denken und nichtmenschliche Aspekte einzubeziehen, viel mehr als meine Generation.
Anmerkungen: 1 Manisha Desai hat ein Buch über Gender und Globalisierung, das Weltsozialforum und seine problematischen „Gender Geographien“ geschrieben. Es thematisiert, wann und wo Frauen auftreten und wann sie welche Fragen zur Sprache bringen. Gender and the Politics of Possibilities: Rethinking Globalization (2008). Gender Lens Series, Rowman and Littlefield. // 2 https://aksharacentre.org
Zur Interviewten: Manisha Desai ist Professorin für Soziologie, Asienwissenschaften und asiatische Amerikanistik an der University of Connecticut. Ihre Schwerpunkte sind transnationale Feminismen, Gender, Globalisierung und Menschenrechte.
Zur Interviewerin: Claudia Dal-Bianco ist Redakteurin der frauen*solidarität.