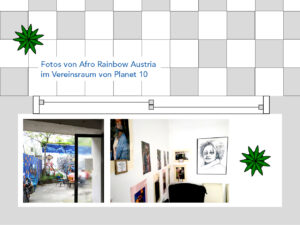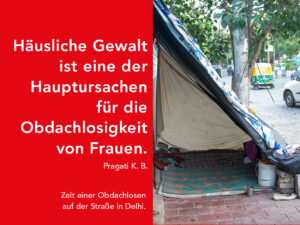Feministische Stadtplanung rückt die Bedürfnisse der Bewohner_innen in den Mittelpunkt und stärkt die Nachbar_innenschaft. Care-Arbeit soll gemeinschaftlich organisiert und Grundbedürfnisse wie Wohnen oder Gesundheit sollen nicht dem Markt unterworfen werden. Einzelne Städte in Spanien und Lateinamerika wagen einen Anfang.
Themen rund um feministische Stadtplanung wurden auf der Konferenz Sorgende Städte im Jänner 2023 in Bremen diskutiert. Die Tagung, ausgerichtet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, gab Impulse für Ansätze aus dem globalen Süden und Norden, um Utopien einer „Stadt für alle“ zu entwickeln1. Klara vom Organisationsteam der Konferenz erklärt, es ginge darum, einen gemeinsamen Startpunkt für die Anforderungen einer feministischen Stadt zu finden, in der Sorge-Arbeit vergesellschaftet ist: „Der gemeinsame Nenner unterschiedlicher Kämpfe in unterschiedlichen Städten ist die Unzufriedenheit mit der Abschiebung der Care-Arbeit in das Private. Dieses Problem soll behoben werden.“
Barcelona als Vorbild
Das Konzept der Sorgenden Städte ist im Kontext eines feministischen Munizipalismus in Spanien entstanden. Diese politische Bewegung zeichnet sich durch ihren partizipativen Charakter aus und umfasst Akteur_innen innerhalb und außerhalb der Stadtregierung. Ihre politischen Ziele entspringen aus dem Beharren und auf der Notwendigkeit, Dinge anders zu machen als bisher. In Barcelona formierte sich diese Bewegung in die Partei Barcelona en Comú. Sie stellt seit 2015 die Stadtregierung. Ada Colau Ballano wurde die erste (wiedergewählte) Bürgermeisterin von Barcelona, deren Programm sich aus Diskussionen in dutzenden Nachbar_innenschaftsversammlungen ergab.
Laura Pérez ist Stadträtin für Feminismus seit der ersten Amtsperiode der Partei. Sie macht sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und für die Rechte von Migrant_innen stark: „Auch wenn man keinen legalen Aufenthaltsstatus hat, sollte man Zugang zur Daseinsfürsorge haben. Wir wollen jeder Frau mehr Zeit geben, zu studieren, zu arbeiten oder einfach einen Kaffee zu trinken. Es ist schwer, sich zurechtzufinden in einer neuen Stadt, wenn frau* niemanden kennt und kein Netzwerk hat.“
Die Lösung liegt für sie in der Dezentralisierung der Politik – raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Nachbar_innenschaft! Pérez’ Plan umfasst verschiedene Maßnahmen, darunter ein Gender-Mainstreaming der Institutionen, Kampf gegen die Feminisierung der Armut oder die Präsenz von Frauen in der Stadt. Sie erklärt: „Frauen arbeiten mehr als Männer und bewegen sich anders in der Stadt. Für Frauen ist der öffentliche Nahverkehr sehr wichtig. Es gilt, diese Unterschiede sichtbar zu machen und die Stadtplanung an die Bedürfnisse der Frauen anzupassen.“
Santiago de Chile
In Chiles Hauptstadt wird das Konzept der Sorgenden Städte anders ausgelegt. Hier werden sogenannte Care-Zentren errichtet, die Frauen* und anderen marginalisierten Gruppen zur Verfügung stehen. Ein großer Unterschied in der feministischen Stadtplanung im Vergleich zu Barcelona ist die fehlende staatliche Unterstützung, die Räume sind rein aus privaten Geldern finanziert.
Rosario Olivares, Koordinatorin des kommunalen Care-Plans in Santiago, erklärt, dass die Bildungsstätten Orte für Solidarität, Freude, Austausch seien und den Bedürfnissen der Besucher_innen entgegenkämen: „Sie sind von der feministischen Bewegung initiiert, um Bewusstsein zu schaffen für die Bedeutung der Care-Arbeit und inkludieren Menschen, die historisch von Aushandlungen ausgeschlossen wurden.
Angesichts des 2022 abgelehnten Verfassungsentwurfs – er sollte Chile von Grund auf umbauen zu einem Sozialstaat, der Frauenrechte und Umweltschutz stärkt, die indigenen Völker anerkennt und sich um das allgemeine Wohlergehen der Menschen kümmert – stellen die Care-Zentren Schutzräume dar, um zur Ruhe kommen und Kräfte bündeln zu können. Olivares: „Bei der Verfassungsabstimmung hatten wir Linken ein Kommunikationsproblem. Daher sind wir gescheitert, aber wir geben nicht auf.“
Argentinischer Munizipalismus
Caren Tepp von Ciudad Futura erklärt, dass es darum geht, „Ungleichheiten zu bekämpfen. Wir wollen die ärmsten Nachbar_innenschaften in unsere Stadt integrieren, sie sollen beispielsweise Wasserzugang haben, jede_r hat Recht auf ein faires Leben.“ Die 2005 gegründete Partei Ciudad Futura entstand als soziale Bewegung in Reaktion auf die zunehmende Bodenspekulation durch Bauunternehmer_innen in den verarmten Außenbezirken der Stadt Rosario. Im Zuge der Stadtreformen wurden Konzepte für Solidarität erarbeitet.
Ein Beispiel: In Zusammenarbeit mit lokalen Landwirt_innen konnten faire Preise für qualitativ hochwertige Produkte erzielt werden. Ernährungssouveränität wird durch dieses Nahversorgungskonzept kollektiv sichergestellt und muss nicht länger individuell erkämpft werden.
Ein anderes Beispiel: Um auf die individuellen Wohnbedürfnisse von Städter_innen eingehen zu können, setzt sich die Ciudad Futura für „Mappings“ in informellen Siedlungen ein. Die konkrete Idee ist, dass die dort Lebenden die Infrastruktur ihrer Wohngebiete auf einer Karte selbst skizzieren. Basierend auf diesen Aufzeichnungen, wird überlegt, wie sich dieser Ort weiterentwickeln soll. Im Zuge dieser Bottom-Up-Prozesse wird also mit Ideen und Anregungen gearbeitet, die von den Betroffenen urbaner Politiken kommen, wodurch etablierte Herrschaftsverhältnisse unterlaufen werden.
Care-Arbeit für alle!
Die Utopien für feministisches Vergesellschaften beginnen an „Orten, wo man sich trifft, plaudert und gemeinsam frühstückt, an Orten, wo man sich politisieren kann“, erklärt Klara von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es geht darum, die Care-Arbeit nach außen zu tragen, in die Nachbar_innenschaft. Güter wie etwa Gesundheit oder Nahrungsmittelversorgung, die zur Daseinsförderung gehören, also Aufgaben und Leistungen, die für ein menschliches Dasein notwendig sind, sollten für alle frei zugänglich sein und nicht zur Ware gemacht werden. In diesem Sinn muss die kritische Infrastruktur, die von wesentlicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen ist, wie etwa der Gesundheit oder des sozialen Wohlergehens der Bevölkerung, selbst verwaltet organisiert sein – staatlich oder nicht-staatlich. Welche Organisationsform ideal ist, um feministisches Vergesellschaften zu realisieren, wird sich in zukünftigen Auseinandersetzungen zeigen.
Anmerkungen: Dieser Artikel ist erstmals in der Zeitschrift an.schläge – Das feministische Magazin (IV/2023) erschienen und wurde leicht gekürzt.
Webtipp: 1 Auf sorgende-staedte.org sind Ergebnisse der Konferenz festgehalten. Ein interaktiver Stadtplan lädt dazu ein, sich in den Häusern der Sorgenden Stadt umzuschauen und mehr über die verschiedenen Konzepte zu erfahren. Dabei werden Projekte aus verschiedenen Teilen der Welt vorgestellt.
Zur Autorin: Tania Napravnik ist freie Journalistin, Projektleiterin der Radioredaktion „Women on Air – Globale Dialoge“ und Assistentin der Geschäftsführung bei COMMIT.