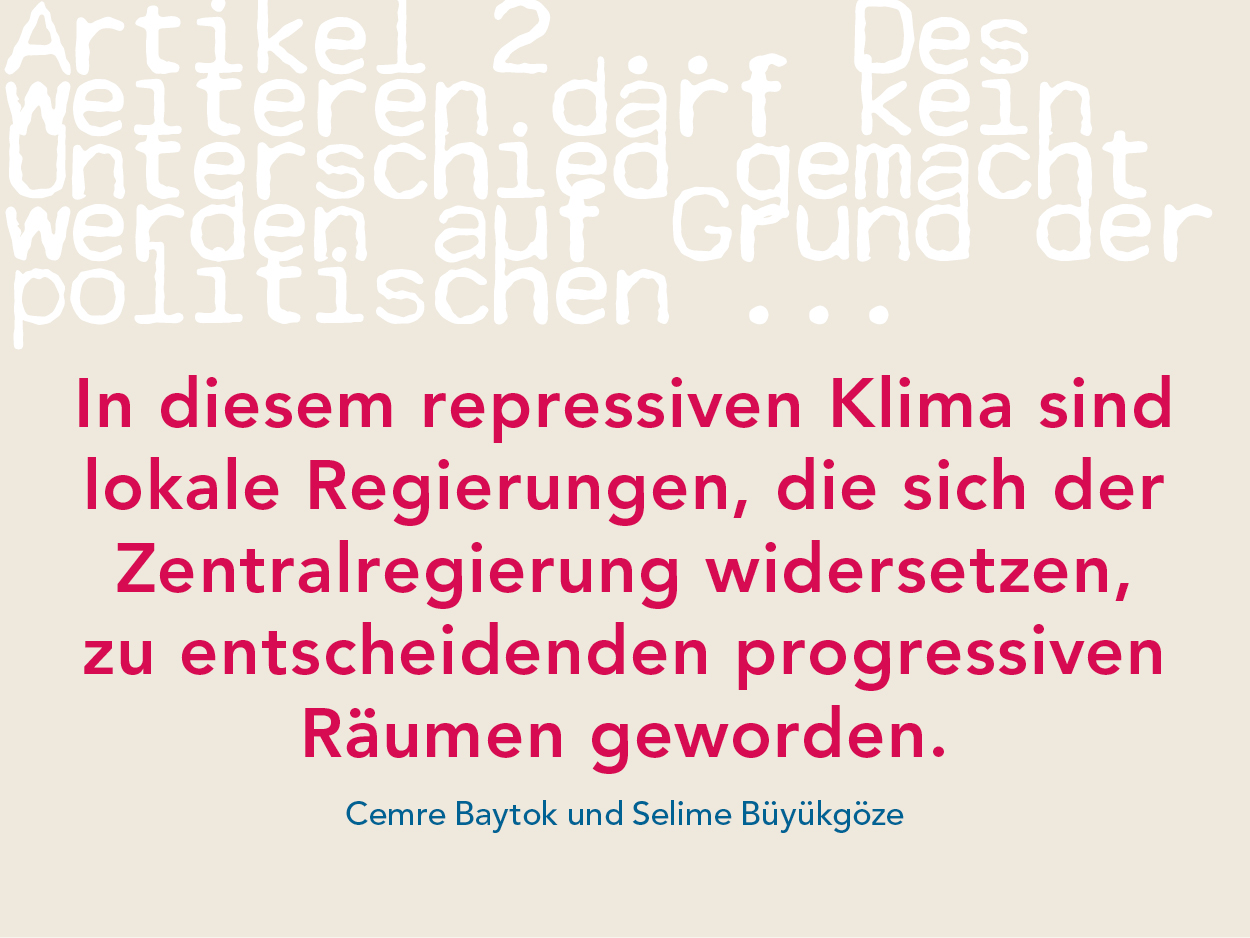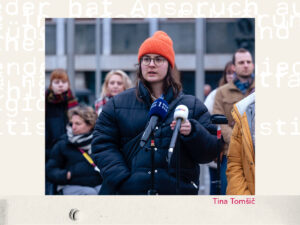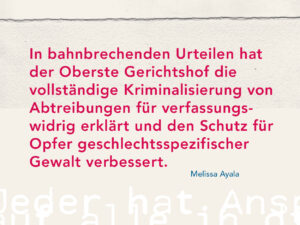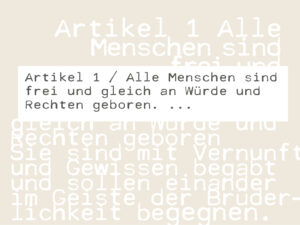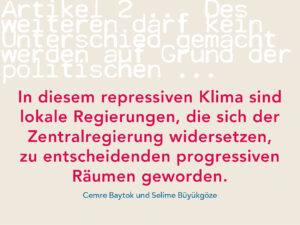Immer wieder werden in der Türkei demokratisch gewählte Bürgermeister_innen durch die Erdoğan-Regierung abgesetzt. Warum die Praxis, staatliche Treuhänder in der Kommunalverwaltung einzusetzen, einen massiven Angriff gegen feministische Politik und Frauenrechte bedeutet.
Bei den Kommunalwahlen in der Türkei am 31. März 2024 musste die seit 22 Jahren regierende AKP deutliche Verluste hinnehmen. Die Parlamentswahlen von 2023 sicherten Erdoğan zwar die Präsidentschaft und die Mehrheit im Parlament, eröffneten aber auch Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft und soziale Bewegungen, sich in der Kommunalpolitik zu organisieren. Die Hoffnungen, die durch lokale Erfolge geweckt wurden, währten jedoch nur kurz. Die AKP setzte totalitäre Taktiken ein und riss die von Oppositionskandidat_innen gewonnenen Sitze mit außergesetzlichen Mitteln wieder an sich.
Die Ernennung staatlicher Treuhänder in lokalen Verwaltungen ist in der Türkei nicht neu. Der Einsatz einer Zwangsverwaltung hat zur Folge, dass ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin und eine von der Bevölkerung gewählte lokale Verwaltung per Regierungsentscheid abgesetzt werden. In der Praxis bedeutet dies oft eine komplette Umstrukturierung der Verwaltung von heute auf morgen, beginnend mit der Ernennung eines neuen Bürgermeisters, der nicht von der Bevölkerung gewählt wurde. Missliebige Personen werden aus den Institutionen entfernt. Ein Dekret des Präsidenten, das während des Ausnahmezustands nach dem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 erlassen wurde, ermöglichte so die Übernahme von 160 Gemeinden durch die Zentralregierung.
Nach den Kommunalwahlen 2019 wurden 59 Treuhänder ernannt; seit 2024 haben diese sieben weitere Gemeinden übernommen, darunter Esenyurt, den bevölkerungsreichsten Bezirk Istanbuls, wo ein Bündnis aus der größten Oppositionspartei und der prokurdischen Partei die Wahlen gewann. Diese Praxis, die sich ursprünglich gegen die kurdischen Gebiete richtete, betrifft nun die gesamte Opposition in der Türkei und ist ein deutliches Beispiel für das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit.
Ausstieg aus der Istanbul-Konvention
Dieses Fehlen von Rechtsstaatlichkeit in der Türkei untergräbt den Zugang zu Grundfreiheiten und gleichen Rechten und schafft einen fruchtbaren Boden für Angriffe auf Frauenrechte. Der Ausstieg des Landes aus der Istanbul-Konvention des Europarats, einem völkerrechtlich bindenden Vertrag über Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen, verdeutlicht diese Erosion. Die Türkei, die die Konvention 2011 als erstes Land unterzeichnet hatte, trat 2021 überraschend aus. Ähnlich wie bei den Zwangsverwaltungen handelt es sich auch hier um eine Entscheidung Erdoğans, die demokratische Prozesse umgeht, schließlich hatte das Parlament die Konvention ratifiziert. Dieser Rückzug bedeutet den Höhepunkt eines Jahrzehnts zunehmender Repression, die mit den Gezi-Protesten 2013 begann und sich nach dem Putschversuch 2016 noch verschärfte. Wie in anderen autoritären Regimen wurde die autoritäre Wende in der Türkei von einer Anti-Gender-Rhetorik und -Politik begleitet.
Die Angriffe auf Frauenrechte in der Türkei werden immer offener geführt, dabei wird gezielt auf Desinformation und Negativ-Kampagnen gesetzt. Ein Beispiel dafür ist die jüngste Debatte über Unterhaltszahlungen, die trotz einer geringen Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben (30 %) und ihrer lebenslangen Belastung durch Care-Arbeit eingeschränkt werden sollen. Diese Bestrebungen zielen darauf ab, die Arbeit von Frauen unsichtbar zu machen und ihre Ansprüche als unverdiente Privilegien abzutun.
Ähnliche manipulative Kampagnen richten sich gegen Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Frauen würden Gewaltschutzgesetze missbrauchen, so die Botschaft hinter den Desinformationskampagnen. Als Beispiel dafür kann die Unterstellung dienen, Frauen würden einstweilige Verfügungen gegen ihre Ehemänner erwirken, um ihre Liebhaber nach Hause einladen zu können.
Fehlender Schutz
Männliche Gewalt ist in der Türkei nach wie vor weit verbreitet. Eine Studie aus dem Jahr 2014 ergab, dass eine von drei Frauen in ihrem Leben körperliche Gewalt erfährt. Allein im Jahr 2024 gab es laut Medienberichten 378 Femizide. Viele Opfer wurden getötet, obwohl sie eine Schutzanordnung erwirkt oder sie bereits Hilfe bei Institutionen gesucht hatten. Diese Fälle verdeutlichen das staatliche Versagen und den mangelnden politischen Willen der Regierung, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Probleme bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen und das Fehlen umfassender Unterstützungssysteme verschärfen dieses Problem noch.
Strafverfolgungsbehörden, insbesondere die Polizei, handeln oft willkürlich und haben bei Fehlverhalten keine Konsequenzen zu befürchten. Immer wieder werden Frauen, die aus einer Gewaltsituation flüchten, in ein gefährliches Umfeld zurückgeschickt. Anstatt gegen diese Versäumnisse vorzugehen, konzentrierten sich Angriffe auf die Istanbul-Konvention auf die Behauptung, diese bedrohe Familienstrukturen und fördere LGBTQ+-Rechte. Diese unbegründeten Vorwürfe schürten Ängste, führten zum Abbau von Schutzmechanismen gegen Gewalt und verstärkten die Diskriminierung von LGBTQ+-Personen. Der Austritt aus der Konvention markiert den Beginn einer Anti-Gender-Politik und Einschränkungen bei LGBTQ+-Rechten, während traditionelle Familienbilder in der Politik gestärkt wurden. Gleichstellungsprogramme, wie etwa ein Strategiepapier zur Gleichstellungspolitik an Universitäten, wurden zurückgezogen und LGBTQ+-Proteste wie die Pride verboten.
Progressive Räume
In diesem repressiven Klima sind lokale Regierungen, die sich der Zentralregierung widersetzen, zu entscheidenden progressiven Räumen geworden. So haben Frauen, die nach den Wahlen 2024 in der kurdischen Region zu Co-Bürgermeisterinnen gewählt wurden, die Kommunen als Zentren der Selbstermächtigung wiederbelebt. Frauenpolitische Abteilungen wurden wiedereröffnet und Initiativen wie Solidaritätszentren, Kooperativen, Kindertagesstätten, die Verteilung kostenloser Menstruationsprodukte, HPV-Impfprogramme und die Jin-Card für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel eingeführt. Über diese Maßnahmen sollten städtische Zentren geschaffen werden, in denen sich Frauen gleichberechtigt im öffentlichen Raum entfalten können. Auch die Zusammenarbeit von Oppositionskräften in der Stadtverwaltung in Istanbul mit Frauenorganisationen zeigt, dass trotz struktureller, politischer und ökonomischer Herausforderungen eine progressive Frauenpolitik möglich ist.
Der Einsatz von Zwangsverwaltungen untergräbt nicht nur demokratische Rechte, sondern verwehrt Frauen den Zugang zu ihren Grundrechten. In der Vergangenheit gehörte die Schließung von Frauenhäusern und anderen Unterstützungsangeboten stets zu den ersten Handlungen der eingesetzten Regierungsvertreter.
Frauen brauchen demokratische Grundrechte, um gleichberechtigt und frei in der Gesellschaft leben zu können. Diese Tatsache verpflichtet Feminist_innen weltweit zum Widerstand gegen autoritäre Regime und antidemokratische Praktiken. Eine Diskriminierung von Frauen, egal wo, verhindert die Befreiung aller Frauen. Auch deshalb kennt feministische Solidarität keine Grenzen.
Über die Autor_innen: Cemre Baytok und Selime Büyükgöze sind seit den 2010er Jahren in der feministischen Bewegung in der Türkei aktiv. Sie waren zunächst Teil des Istanbul Feminist Collective und 2016 Mitgründerinnen des feministischen Blogs Çatlak Zemin. Außerdem arbeiten sie ehrenamtlich bei der Mor Çatı Women’s Shelter Foundation, einer feministischen Organisation mit 35-jähriger Geschichte. Seit Kurzem engagieren sie sich im neu gegründeten Aralık Feminist Collective in Istanbul.